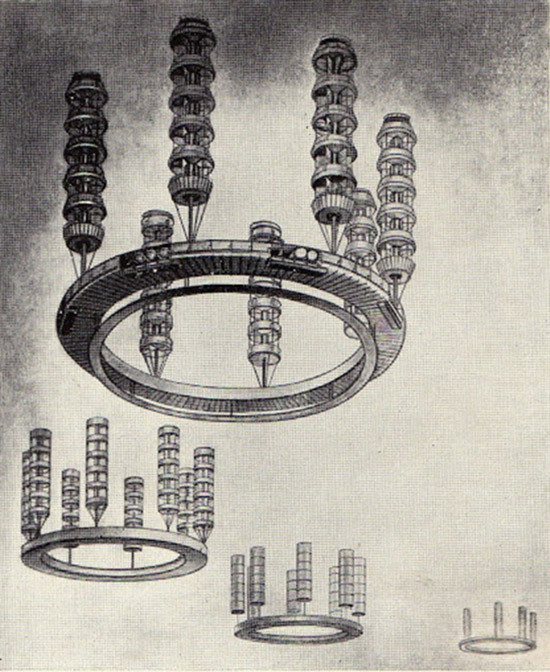Warum Berlin nun Klimahauptstadt ist. Im Gespräch mit Mao Luder-Litze – dem Urgestein der Klimabewegung
Mao Luder-Litze setzt sich seit vielen Jahren für eine sozial-ökologische Transformation ein. Er war aktiv in der Klimabewegung, sowohl als theoretischer Wegbereiter als auch unmittelbar in Aktionen zivilen Ungehorsams in diversen Kohlerevieren. Bella Luft vom Berliner Morgenrot traf sich mit ihm, um über fehlende rote Sonnenuntergänge zu sprechen und wie es dazu kam, dass sich Berlin mittlerweile stolz Klimahauptstadt nennen kann.
BL: Früher kannten wir Berlin vor allem als arm, dreckig aber sexy – und nicht gerade als Hochburg der Umweltbewegung. Heute kommen StadtplanerInnen aus der ganzen Welt hierher, um von Berlin zu lernen. Wie kam es dazu – wie wurde alles besser?
ML: Naja. Nicht alles. Damals gab es noch diese wunderschönen Sonnenuntergänge, eine brillanten Kombination von gelb, rot und orange. War nur leider das Resultat der Tatsache, dass Berlin damals eine der höchsten Feinstaubbelastungen deutscher Großstädte hatte.
BL: Danke, dass Du uns an Deinen Erinnerungen teilhaben lässt, Opa. Aber was unsere LeserInnen wissen wollen ist: was habt Ihr damals gemacht, um das zu ändern?
ML: Ich glaube, der Sommer 2017 war der Wendepunkt. Damals sahen wir uns einem massiven Rechtsruck ausgesetzt, linke Bewegungen und Parteien schienen zu schwächeln, wir hatten das Gefühl, tief in der Scheiße zu stecken. Dann ging es plötzlich Schlag-auf-Schlag. Zuerst kamen die G20-Proteste in Hamburg. Das setzte ein Zeichen, dass linke und ökologisch gerechte Alternativen realistisch und durchsetzbar sind. Kurz nach den G20, ich glaube, es war im August, hatte die Anti-Braunkohle-Kampagne Ende Gelände eine große Aktion im Rheinland geplant. Zu diesem Zeitpunkt war Deutschland der weltweit führende Produzent von Braunkohle, dem dreckigsten aller Energieträger. Da tauchten statt der erwarteten 5.000 Leute sage und schreibe 20.000 Menschen auf, und legten für eine ganze Woche das rheinische Braunkohlerevier lahm. Als dann bei der Bundestagswahl die Rechten baden gingen, und eine Mitte-Links Regierung an die Macht kam, stand diese unter enormem Druck der Klimabewegung, einen schnellen Kohleausstieg zu verabschieden, wozu es dann auch kam.
BL: Schön und gut. Aber Berlin?
ML: In Berlin gab’s gleich mehrere Auseinandersetzungen. Zuerst die um das Stromnetz: seit Jahren hatten mehrere Bewegungen auf rechtlichem Wege dafür gekämpft, das Stromnetz zu ‚rekommunalisieren‘. Ich weiß, das ist heute kaum noch vorstellbar: damals waren die Stromnetze doch tatsächlich in privater Hand. Man war wirklich der Meinung, dass es das Beste für alle wäre, wenn einige wenige Konzerne die Macht über die Energieversorgung besitzen. Mit dem Druck riesiger Proteste wurde dann aber die Rekommunalisierung durchgesetzt. Schwierig war das auch mit der energetischen Gebäudesanierung: Die Situation war so: wir Klima-AktivistInnen hatten Angst, dass wir in einen Konflikt geraten weil wir die Gebäudesanierung aus einer Klimagerechtigkeitsperspektive heraus echt notwendig finden. Damit wurden aber auch oft Mietsteigerungen gerechtfertigt. Die Lösung: Durch die Rekommunalisierung eines Großteils der Wohnungen, konnte eine energetische Sanierung von Wohnungen besser umgesetzt werden. Die Kosten der Sanierung erfolgte durch eine Art ‚Kurtaxe‘, gepaart mit Einnahmen aus einer Vermögenssteuer. Heute sind fast alle Häuser in Berlin energetisch saniert, und die meisten haben oben auf den Dächern Solarmodule. Manchmal denke ich, das Glitzern über den Dächern Berlins versöhnt mich ein Bisschen mit dem Verschwinden der roten Feinstaubsonnenuntergänge..